Verteilung von Windows 10 und Anwendungen mit Microsoft-Tools (1)
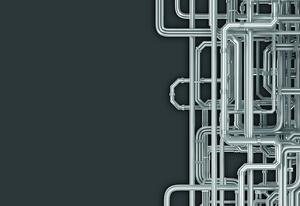
Verteilsystem
Das Microsoft Deployment Toolkit (MDT) [1, 2] reiht sich in die lange Geschichte der Unattended-Installationswerkzeuge für Windows. IT-Verantwortliche, die MDT für sich entdeckt haben, nutzten zuvor meist ein Imaging-Werkzeug für die Installation von Systemen. Microsoft selbst bietet hier WDS an (Windows Deployment Service), bis Windows Server 2003 R2 als RIS (Re-
mote-Install-Server) bekannt. Mit Server 2008 kam dann die Möglichkeit, Treiber dem Image dynamisch anhand eines Hardwaremodels mitzugeben. Damit kann der monolithische Block auf unterschiedlicher Hardware ohne viel Nacharbeit angewendet werden.
Nachteile des Betriebssystem-Imaging
Das Gute am Image-Ansatz ist die Vollständigkeit. Je genauer Sie ein Image hinsichtlich Hardware, Sprache, Software und Treiber
...Der komplette Artikel ist nur für Abonnenten des ADMIN Archiv-Abos verfügbar.










