Grundlagen, Standards und Anwendungen des Internet of Things
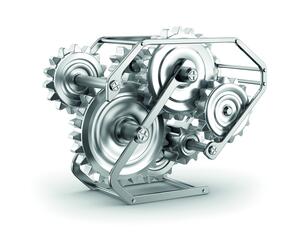
Feinjustierung dringend geboten
Grundsätzlich bezeichnet das Internet of Things die Ausrüstung aller möglichen Gegenstände mit Sensoren, maschineller Intelligenz und Telekommunikationsmöglichkeiten, über die die Geräte untereinander und mit übergeordneten Steuerungsebenen Daten austauschen (sogenannte cyber-physikalische Systeme). Die Anreicherung der auf der Geräteebene erzeugten Daten mit Daten aus anderen Quellen und ihre Analyse führen dann idealerweise zu intelligenten, situationsangepassten und teils autonomen (Re)Aktionen auf Geräte- oder Systemebene.
Außerdem ergibt sich die Möglichkeit, aus den gewonnenen Daten beziehungsweise Erkenntnissen neue Dienste zu generieren. Letztere sollen die Quelle zusätzlicher Gewinne für die Unternehmen werden. Weil sich sogenannte IoT-Ökosysteme grundsätzlich über alle sieben Schichten informationstechnischer Systeme erstrecken und unterschiedliche Akteure einbinden, müssen häufig vollkommen neue Modelle der Gewinnerzeugung und -verteilung entwickelt werden.
Beispiel autonomes, vernetztes Fahren: Involviert ist hier einmal der Hersteller des Fahrzeuges mit seinen Zulieferern. Weiter der Betreiber des Straßennetzes, die
...Der komplette Artikel ist nur für Abonnenten des ADMIN Archiv-Abos verfügbar.










