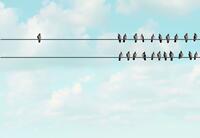Nicht ohne Probleme
Probleme mit NoSQL-Datenbanken lauern oft da, wo mit dieser jungen Datenbankgeneration noch keine Erfahrungen vorliegen. So hatte die Firma Foursquare kürzlich eine Downtime durch die NoSQL-Datenbank MongoDB Probleme [14] . Im Einsatz waren zwei große Amazon EC2-Instanzen mit je 66 GByte RAM. Jedoch wuchs der Speicherbedarf (MongoDB nutzt hier Memory Mapped Files im RAM) bei einer Instanz auf über 66 GByte und bei der anderen auf 50 GByte. Dies konnte nicht einfach repariert werden, wäre aber durch Überwachung und Hinzufügen einer neuen EC2 Instanz leicht vermeidbar gewesen.
Abschließend soll an dieser Stelle auf zwei Trends hingewiesen werden, die auch die NoSQL-Datenbankwelt beeinflussen:
- Oft hat ein Unternehmen hohe Persistenzanforderungen. In Zukunft werden diese immer öfter mit mehreren Datenbanken gelöst. Es gibt schon viele praktische Beispiele zum hervorragenden Zusammenspiel der relationalen Welt mit NoSQL. Auch gibt es schon einige Hybridlösungen wie etwa HadoopDB. Hier sollte man nicht voreilig mit dem Argument der Maintenance-Kosten den Aufbau einer Multi-DB-Umgebung verhindern.
- Mit der Geschwindigkeit, mit der Cloud-Lösungen und Virtualisierung weiter voranschreiten, wird auch das Datenbank-Hosting zunehmen. Künftig wird es auf Cloud-Umgebungen wie Amazon AWS oder Rackspace viele Dutzende von gehosteten Datenbanklösungen geben. Hier ist bereits von DaaS (Database as a Service) die Rede. Die Kunst dabei wird zukünftig immer mehr darin bestehen, für die Menge der Anforderungen die richtige Mischung an DaaS-Lösungen zu finden.
Infos
- Stefan Edlich, Achim Friedland, Jens Hampe, Benjamin Brauer, "Einstieg in die Welt nichtrelationaler Web 2.0 Datenbanken", 2010, Hanser Verlag
- NoSQL-Website: http://nosql-database.org
- Apache Thrift: http://incubator.apache.org/thrift
- LINQ: http://de.wikipedia.org/wiki/LINQ
- Map/Reduce-Technik: http://labs.google.com/papers/mapreduce.html
- Amazon's Dynamo Technology: http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dynamo.html
- Eventually Consistent: http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1466448
- MVCC: http://en.wikipedia.org/wiki/Multiversion_concurrency_control
- Vector Clocks: http://blog.basho.com/2010/01/29/why-vector-clocksare-easy
- Paxos Family of Consensus Protocols: http://sites.google.com/site/brturn2/paxosfamily
- JSON: http://json.org
- Graphen: http://arxiv.org/abs/1006.2361
- Tinkerpop: http://www.tinkerpop.com
- Probleme beim Sharding: http://highscalability.com/blog/2010/10/15/troubles-with-sharding-what-can-we-learn-from-the-foursquare.html

CouchDB-Gründer verabschiedet sich von Apache-Projekt
Der Erfinder der NoSQL-Datenbank CouchDB wendet sich vom Apache-Projekt ab und widmet sich der Neuentwicklung seiner Datenbank unter dem Namen Couchbase. Im CouchDB-Markt konkurrierende Unternehmen stecken nun ihre Felder ab.